Geboren 1950 in Kumla, arbeitete Håkan Nesser zunächst als Lehrer in Uppsala bevor er sich Vollzeit der Schriftstellerei widmete und so wunderbare Bücher wie „Die Schatten und der Regen“ oder „Und Piccadilly Circus liegt nicht in Kumla“ schrieb. Seit seinem Debütroman „Koreografen“ (der nie ins Deutsche übersetzt wurde) hat er über 20 Bücher veröffentlicht, die in etwa zwei Dutzend Sprachen übersetzt wurden und zählt mittlerweile zu den spannendsten und erfolgreichsten Autoren Skandinaviens.
Seine Romane sind kunstvoll. Sie bestechen mit einer anspruchsvollen, manchmal fast lyrischen Sprache, komplexen Figuren und Handlungen, die sich an teils realen, teils fiktiven Schauplätzen austragen. Mit „Am Abend des Mordes“ beendete er 2012 seine Serie um den Kriminalkommissar Gunnar Barbarotti. In Deutschland erschien zuletzt „Die Lebenden und Toten von Winsford“.
Nach New York („Die Perspektive des Gärtners“) und London („Himmel über London“) wählte Håkan Nesser Berlin als Schauplatz seines neuen Buches. Als er im November noch einmal für Recherchen nach Berlin kam, nutzte ich die Gelegenheit, um mit ihm beim Frühstück über das „Berlin-Buch“, seine Arbeit als Autor, die Besonderheit der deutschen Leser und über das nicht enden wollende Phänomen des „Schwedenkrimis“ zu sprechen.
Hier geht’s zum Interview auf Schwedisch. Intervjun på svenska.
Hallo und guten Morgen, Håkan Nesser.
Guten Morgen.
Es ist sehr nett, dich kennenzulernen und ich freue mich auch sehr, dass du dich für dieses Interview bereit erklärt hast! Wie gefällt es dir denn in Berlin?
Ich fühle mich sehr wohl in Berlin. Es ist ziemlich schönes Wetter, das ist fantastisch! Gestern bin ich durch den Tiergarten gewandert und es fühlt sich ja wirklich noch wie September an, obwohl es schon November ist.
Dein Buch „Die Lebenden und Toten von Winsford“, was jetzt in Deutschland herausgekommen ist, hast du aus einer weiblichen Perspektive geschrieben, d.h. deine Hauptperson ist eine Frau. Wie hat sich das angefühlt?
Risky (Schmunzelt). Aber eigentlich habe ich das vorher auch schon mal gemacht. Zwar kein ganzes Buch, aber in einigen Kapiteln. Ich finde das nicht besonders kontrovers.
 Aber fühlt sich es genauso an wie aus einer männlichen Perspektive zu schreiben oder doch schwerer?
Aber fühlt sich es genauso an wie aus einer männlichen Perspektive zu schreiben oder doch schwerer?
Das Schwierige und Merkwürdige ist ja, überhaupt in den Kopf einer anderen Person zu gehen. Zu glauben, dass man in gewisser Weise eine andere Person erschaffen kann und diese dann zu verstehen und wie sie zu handeln.
Das ist es ja, worum es beim Schreiben geht: In den Kopf einer anderen Person zu gehen und zu versuchen, in der Psyche dieser Person zu graben. Das kann ein 12-jähriger Junge sein oder eine 75-jährige Dame. Genau das – in den Kopf einer anderen Person zu gehen – das ist der Schritt, den man gehen muss. Man muss sich trauen, diesen Schritt zu gehen, anders geht es nicht.
Aber wie stellst du das an? Deine Charaktere sind ja oft sehr detailliert und fast psychologisch dargestellt. Ist das alles Phantasie?
Ja, doch das ist es.
Du hast keine Vorbilder für deine Figuren?
Nein, eigentlich nicht. Die einzige Regel, die ich habe, ist, dass ich das schreibe, was ich selbst lesen wollen würde. Würde ich das als Leser tolerieren, glaube ich es oder nicht?
Man muss als Autor auch Leser sein. Die ganze Zeit. Und dann muss man beurteilen: Würde sie oder er so handeln, würde sie oder er so denken? Und dann muss man darauf vertrauen, dass man eine Art Intuition oder ein gut feeling dafür hat, dass es funktioniert. Es gibt keine andere Methode.
Wenn ich anfange zu schreiben, weiß ich noch nicht alles über eine Person. Viele Autoren planen ja viel im Voraus. Aber ich fange immer schon sehr früh an zu schreiben und während des Schreibens entwickeln sich die Charaktere auf eine organische Weise, so zu sagen.
Jetzt bist du in Berlin, um für dein neues Buch zu recherchieren. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen?
Ich war schon mal im April hier. Jetzt laufe ich umher und schaue mir die Sachen an, die ich mir anschauen muss und überprüfe einige Details. Und dann werde ich das Buch noch mal umschreiben.
Ich brauche nämlich noch ein paar Adressen, vor allem in der Knobelsdorffstraße und der Kyffhäuserstraße. Aber ab einer gewissen Stelle muss ich anfangen zu lügen. Ich kann nicht die Hausnummern nehmen, die es wirklich gibt. Ich kann nicht schreiben „Kyffhäuserstraße 22“, weil es die ja gibt. Und das muss ich heute überprüfen. Aber die Knobelsdorffstraße ist so wahnsinnig lang, die Hausnummern gehen wohl fast bis 100. Da werde ich eine Adresse „B“ nennen, denn es gibt dort keine Nummern mit A und B. Dort habe ich dann also eine Adresse die „Knobelsdorffstraße 36B“ heißt. 36 gibt es, aber nicht 36B.
Die Orte sind schon authentisch, aber irgendwo muss die Fiktion beginnen. Man muss an einer Stelle lügen dürfen.
Wenn ich wieder nach Hause nach Schweden komme, werde ich das Buch dem Verlag übergeben. In Schweden soll es dann im August 2015 herauskommen und es wird „Elva dagar i Berlin“ (dt.: Elf Tage in Berlin) heißen.
Berlin steht also schon im Titel!
Ja, es handelt ja schließlich von Berlin. Jetzt bin ich ja… Ich bin kein Berliner – leider.
War es denn nicht auch geplant nach Berlin zu ziehen?
Doch, aber das war kein Plan, das war eine Ambition! Wir wollten zu erst in New York, dann London und dann in Berlin wohnen.
Meine Frau ist Ärztin und jetzt hat sie in Schweden einen guten Job und da muss es reichen fürs recherchieren herzukommen.
Man wechselt das Land nicht so häufig. Da gibt es eben auch praktische Probleme. Es ist recht nervig mit den unterschiedlichen Steuersystemen – ich habe das in den USA und in London gemacht… Es reicht hierher zu fahren.
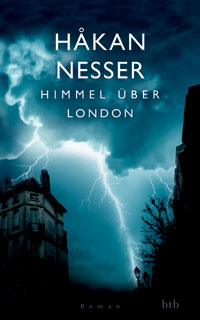 Deine Erzählungen sind oftmals sehr komplex. In „Himmel über London“ zum Beispiel hattest du unterschiedliche Zeitebenen, dann flechtest du häufig literarische Referenzen ein usw. Kommt das während des Schreibens oder machst du dir da vorher einen Plan?
Deine Erzählungen sind oftmals sehr komplex. In „Himmel über London“ zum Beispiel hattest du unterschiedliche Zeitebenen, dann flechtest du häufig literarische Referenzen ein usw. Kommt das während des Schreibens oder machst du dir da vorher einen Plan?
Ja, doch. Ich habe schon einen Plan. Aber das ist auch von Buch zu Buch verschieden. Das London-Buch ist auch komplex, das kann man schon sagen. Da hatte ich den Plan, dass in der Mitte des Buches etwas passieren wird. Da taucht dann eine neue Person auf, über die zunächst niemand etwas weiß und die sich dann als der Erzähler herausstellt. Also das wusste ich natürlich.
Aber man sollte sich keinen zu detaillierten Plan machen, sonst verliert man die Freude am Schreiben. Oder man tötet sogar den kreativen Prozess, wenn man schon zu viel festgelegt hat. Denn – egal ob du Musik komponierst oder malst – es muss die Möglichkeit geben, dass Sachen passieren, noch während du daran arbeitest.
Du musst Eindrücke aufnehmen können. Diese Eindrücke sind wichtig, denn das ist es, was Schaffen ausmacht. Wenn man sich schon von Anfang an verschließt und einen zu strikten Plan hat, verliert man die Schreibfreude.
In der Schule habe ich gelernt, Literatur auf der Grundlage der Biografie des Autors zu interpretieren. An der Uni hieß es dann „der Autor ist tot“…
(Lacht) Ah der Dekonstruktivismus, ja ja…
Und du deklarierst „der Autor ist auch Leser“.
Ich finde auch, dass der Fokus auf den Autor etwas zu stark ist. Denn die Erzählung sollte im Zentrum stehen. Der Sinn eines Buches ist das Leseerlebnis. Natürlich muss es auch einen Verfasser geben, sonst gibt es kein Buch. Aber es ist das Leseerlebnis, das im Zentrum steht.
Und als Autor denke ich nicht daran, was der Leser haben will, sondern ich beurteile den Text durch die Augen des Lesers. Und diese Perspektive muss ich beim Schreiben so früh wie möglich einnehmen, anders geht es nicht.
Jetzt sitze ich ja gerade am Berlin-Buch. Es ist im Grunde fertig, aber jetzt füge ich noch Referenzen ein. Und dabei bin ich Leser und sehe, was ich besser formulieren muss und was nicht gut ist.
Die Geschichte soll ja für beide packend sein – für den Autor und den Leser.
Und die biografische Literaturgeschichte finde ich… It’s overrated (lächelt). Das war schon immer so. Und vielleicht überdeutet man dann auch: „Hier dachte Thomas Mann an dieses und jenes…“
Das tat er überhaupt nicht! Er schrieb einfach eine Erzählung! Es ist sehr leicht zu glauben, dass Dinge durchdachter sind, als es eigentlich der Fall ist.
Ich finde, dass du einen sehr speziellen Ausdruck und eine fast lyrische Sprache hast.
Wenn ich einen Text umschreibe – und das tue ich vielleicht zehn mal – dann sind es die ganze Zeit sprachliche Verbesserungen. Das ist es worum es geht.
Daran arbeitest du am meisten?
Ja! Manchmal findet man den richtigen Ausdruck auf Anhieb. Aber ich schreibe recht schnell – zwischen fünf und zehn Seiten am Tag – und da landen nicht alle Worte richtig. Wenn man es sich dann noch mal durchliest, sieht man Wiederholungen und schlechte Formulierungen. Es geht immer Sachen noch besser zu machen. Sprache ist unerhört wichtig.
Denkst du, dass du in Deutschland ein anderes Publikum hast als woanders?
Ja, das tue ich!
Auf welche Weise unterscheidet sich der deutsche Leser von anderen?
Ja, also ihr Deutschen seid die besten Leser der Welt! Das ist so.
Meinst du das ernst?
Ja, das meine ich ernst! Ich war schon in vielen Ländern und ich weiß nicht was es ist, aber… Eine Lesung in Deutschland kann ja so aussehen, dass ein Autor kommt und sagt „Guten Tag, ich heiße… und das ist mein Buch…“. Und dann kann er 45 Minuten lesen und alle sitzen da und hören zu! Das funktioniert nur in Deutschland. In Deutschland gibt es eine Art Respekt für Texte oder für das Wort, den es nirgends sonst gibt.
Aber das hängt sicher auch davon ab, wer was liest…
Ja, aber trotzdem. Lesungen haben auch eine Tradition in Deutschland. In Schweden wird es jetzt auch mehr so, dass man sich unterhält, Fragen stellt, eine Diskussion hat. In Frankreich sitzt man immer in einer Podiumsrunde, mit sieben Personen und einem Moderator. Und dann spricht man und spricht und spricht… Aber liest eben nie Texte. Franzosen lieben es in einem Podium zu sitzen und sich zu unterhalten. Und das Publikum will es ja so.
Aber hier ist das nicht so. Hier ist es ein Autor und ein Text! Und dann hört man sich den Text an. Ich glaube, dass Leute hier auch mehr lesen und dass auch mehr Bücher verkauft werden. Ihr habt ein einzigartiges Verhältnis zu Büchern und Lesungen.
Und sind Lesungen nur ein Teil deines Jobs oder auch etwas, das du gern machst?
Beides! Ich würde es nicht zu häufig machen wollen.
Aber ich kann so ja auch die Welt sehen. Das machen zu dürfen, ist schließlich auch ein Privileg. Und natürlich denke ich, dass es einen Sinn hat, sonst würde ich es nicht machen.
Und wenn ich Lesungen zusammen mit Dietmar Bär und Margarete von Schwarzkopf machen kann, ist es ideal. Dietmar Bär ist einfach fantastisch! Und Margarete von Schwarzkopf moderiert so leicht und elegant. In dieser Gesellschaft ist es fantastisch.
Wie sieht es mit Interviews aus?
Ich mag es schon mich zu unterhalten, aber es kommt auch ein bisschen darauf an. Du bist vorbereitet, aber manchmal hab ich Interviewer, vor allem in Schweden vielleicht, die nicht das Buch gelesen haben und die von einer Zeitung losgeschickt werden. Dann wird es peinlich. Da bekommt man dann Fragen wie „Kannst du ein bisschen von deinem neuen Buch erzählen?“. Und da merkt man dann, dass sie das Buch nicht gelesen haben und nicht wissen worum es geht. Interviews sind gut, wenn der Interviewer sich belesen hat und Ahnung hat. Dann ist es gut, sonst kann es etwas peinlich sein.
Abgesehen davon, was war die dümmste Frage, die dir je gestellt wurde?
Die dümmste Frage? Die kam von einer Frau, die fragte, warum Van Veeteren nie Milch trinkt. Aber das war keine Journalistin, sondern jemand im Publikum. „Why does Van Veeteren never drink milk?“ (imitiert im ernsten Tonfall).
Ja… das war die schwierigste…
In den Büchern geht er auch nie auf Toilette… vielleicht sollte man das schreiben.
Vielleicht auch nicht.
Gibt es dagegen eine Frage, die du dir wünschst, gestellt zu bekommen?
Nein… Wenn ich eine gute Antwort hätte, würde ich die so oder so geben. Man kann ja eine Frage gestellt bekommen und auf eine andere antworten. Das passiert doch häufig, oder (lacht)?
Bisher geht es ganz gut.
Wenn wir noch mal auf deine Bücher zurückkommen. Du sagtest, dass du nicht so viel im Voraus planst. Aber wie war das bei den Serien? Über Barbarotti hast du mal gesagt, dass du eigentlich keinen Krimi geplant hattest und Barbarotti selbst taucht ja auch erst sehr spät auf. Aber irgendwann wusstest du ja, dass es fünf Bücher werden sollen.
Das wichtigste war, dass die Bücher unterschiedlich werden sollten. Das sind sehr unterschiedliche Geschichten, die auch auf unterschiedliche Weise erzählt werden. Zum Beispiel „Das zweite Leben des Herrn Roos“, das ist kein Kriminalroman. Es steht mit Barbarotti im Zusammenhang, aber ist fast kein Krimi.
Aber was ich sicher im Voraus geplant habe, außer dass sie unterschiedlich sein sollten, war das Verhältnis Barbarotti/Gott, dass das an Tiefe gewinnen sollte. Das beginnt ja auf eher scherzhafte Weise, wie ein Spiel und dann sollte die Perspektive immer ernsthafter werden. Das wusste ich von Anfang an. Aber das war es eigentlich.
Und wann wusstest du, dass Marianne sterben wird?
Sie hat ja schon in im vierten Buch eine erste Warnung erhalten und da wusste ich, dass es in Buch fünf passieren wird und auch, dass das mit dem Tod beginnen soll.
Denkst du denn, dass das Buch schlechter geworden wäre, wenn sie nicht gestorben wäre?
(Zögert) Jaaa… ich wollte ja über Trauer schreiben. Darüber wie man weitermacht, wenn man eigentlich nicht leben will. Das ist ja ein fantastisch gewöhnliches Thema: Wie geht man mit Trauer um? Wie geht man weiter, wenn alles, was es gab, nicht mehr da ist? Das war es also, worüber ich schreiben wollte und da gab es keine andere Möglichkeit, das zu machen. Leider.
Und was hältst du davon, wenn Leser enttäuscht oder sogar wütend reagieren?
Naja, sie müssen halt damit leben. Ich bestimme schließlich!
2009 hast du in einem Interview gesagt, dass du glaubst, dass die „Schwedenhysterie“ in zwei bis drei Jahren vorbei sein wird. Was denkst du jetzt?
Normalerweise sollten solche Dinge wie der Schwedenkrimi fünf Jahre haben und dann geht es vorbei. Durch Stieg Larsson wurde es aber verlängert. Aber Deutschland/Schweden, das ist ja eine sehr spezielle Liebe oder Verbindung, die sehr stark ist. Dann ist Skandinavien außerdem durch die ganzen Filme und so weiter sehr populär. Aber ich denke trotzdem it will pass.
Beobachtest du die schwedischen Literaturveröffentlichungen?
Ich lese fast gar keine Kriminalromane, aber ich lese viele Neuerscheinungen.
Und was war da das letzte, was dir gefallen hat?
Das war wohl Steve Sem-Sandberg aus Wien. Er hat den Augustpreis für „Die Elenden von Lódz“ bekommen. Das handelt von einem jüdischen Ghetto in Polen. Und jetzt kam „Die Auserwählten“ [noch nicht auf Deutsch erschienen] über Spiegelgrund, einem Teil der Anstalt Steinhof in Wien, wo Kinder eingeliefert und hingerichtet wurden. Das ist unglaublich gut geschrieben.
Dann noch Sara Stridsberg, Kristofer Ahlström… viele…
Fühlst du durch die große Konkurrenz der Menge an schwedischen Schriftstellern irgendeinen Verkaufsdruck?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin 64 und ich habe meinen Teil geleistet. Ich habe 27 Bücher geschrieben. Ich brauche auch keins mehr zu schreiben. Ich habe in fast 25 Jahren jedes Jahr ein Buch herausgebracht. Nein, ich fühle keinen Druck.
Und hattest du je das Gefühl, dass es gewisse Erwartungen daran gibt was du schreibst oder auf welche Weise?
Nein, ich bin da ganz frei. Das Berlin-Buch zum Beispiel ist ein heiteres Buch, also es ist längst nicht so schwarz wie die anderen. Es hat nicht diese Dunkelheit. Tage Danielsson – ich w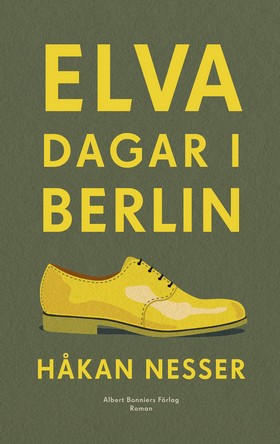 eiß nicht, ob du ihn kennst, ein unglaublich begabter Komiker – er hat „Erzählungen für Kinder über 18 Jahren“ herausgegeben. Und dieses Berlin-Buch hat den Untertitel „Erzählung für Kinder über 18 Jahren“.
eiß nicht, ob du ihn kennst, ein unglaublich begabter Komiker – er hat „Erzählungen für Kinder über 18 Jahren“ herausgegeben. Und dieses Berlin-Buch hat den Untertitel „Erzählung für Kinder über 18 Jahren“.
Kannst du etwas über den Protagonisten verraten?
Ja, klar. Das ist ein junger Mann aus Schweden, der nach Berlin kommt. Er ist etwas retarded wie man auf englisch sagt. In seiner Kindheit hatte er einen Unfall. Er kommt nach Berlin aus einem bestimmten Grund. Als sein Vater stirbt, erzählt er ihm „Deine Mutter ist nicht tot“. Er ist nur mit seinem Vater aufgewachsen, denn seine Mama starb, als er sehr jung war – das hat zumindest der Vater gesagt. Aber so war es nicht. Und das erfährt er, als sein Vater im Sterben liegt. „Deine Mama hat uns verlassen und ist nach Berlin gegangen“. Er ist nun 35 Jahre alt und hat ihre Adresse. „Du sollst hinfahren und nach ihr suchen und ihr das hier geben“. Und das macht er dann.
Wird das wirklich das vorletzte Buch, so wie du es mal in einem Interview gesagt hast? Es gibt sicher viele, die das nicht hoffen.
Ja, aber jedes Buch muss ja gewissermaßen etwas Neues haben. Ich arbeite an einem weiteren, aber dann weiß ich nicht.
Vielleicht kann ich ja auch gar nicht aufhören. Vielleicht sitze ich hier noch in zehn Jahren, esse Frühstück und erzähle, dass ich aufhören werde. Ich weiß es nicht.
Vielen Dank für das Interview!

 Håkan Nesser in Berlin, Foto: Besser Nord als nie!
Håkan Nesser in Berlin, Foto: Besser Nord als nie!
Pingback: "Strafe" von Håkan Nesser und Paula Polanski